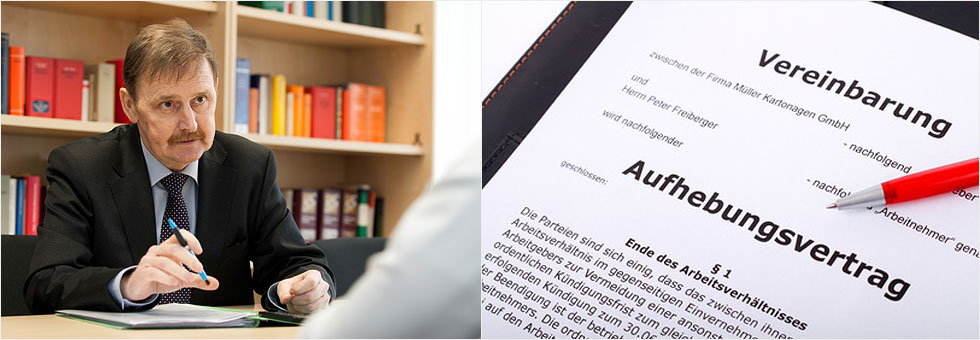
In einer aktuellen Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Niedersachsen, Urteil vom 09.12.2024 – 4 SLa 52/24, ging es um die Frage, ob und wie eine fehlende Arbeitszeiterfassung des Arbeitgebers bei der Geltendmachung von Überstundenvergütung durch eine Arbeitnehmerin zu berücksichtigen ist.
Im vorliegenden Fall war eine Arbeitnehmerin als Lageristin und Bürokraft in einer Autowerkstatt mit angeschlossenem Gebrauchtfahrzeughandel beschäftigt. Die regelmäßigen Öffnungszeiten waren Montag bis Donnerstag von 8 bis 18 Uhr, freitags von 8 bis 17 Uhr. Die Arbeitnehmerin hatte täglich eine Pause im Umfang von einer Stunde. Der Arbeitsvertrag aus 2012 sah eine regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit von 24 Stunden vor.
Die Arbeitnehmerin klagte nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses auf die Vergütung von Überstunden im Umfang von wöchentlich mehr als 20 Stunden. Zur Begründung führte die Arbeitnehmerin aus, dass sie sich während der gesamten Öffnungszeit in der Werkstatt aufgehalten habe, ausgenommen Tage, die Urlaubs oder Krankheitstage waren. Sie habe daher mehr als vertraglich vereinbart gearbeitet.
Sie habe nach Vereinbarung auch samstags von 9 bis 12 Uhr gearbeitet. Zum Beweis ihres Vortrages legte die Arbeitnehmerin erstinstanzlich eine von ihr gefertigte tabellarische Übersicht vor, aus der sich die geleisteten Stunden verteilt auf die Arbeitstage ergaben.
Der Arbeitgeber berief sich darauf, dass die Gesamtzahl an geltend gemachten Überstunden (ca. 3384 Stunden Mehrarbeit über einen Zeitraum von 3 Jahren) unmöglich hätten anfallen können. Dies widerspräche jeder Lebenserfahrung. Aus diesem Grund sei es ihm nicht möglich, zu der tabellarischen Übersicht sinnvoll Stellung zu nehmen.
Hierzu muss man wissen, dass bei der Geltendmachung von Überstundenvergütungsansprüchen der Arbeitnehmer zunächst vortragen muss, wann er wie viel Arbeit geleistet oder sich auf Weisung des Arbeitgebers zur Arbeit bereitgehalten hat. Hierbei geht es darum, ob die geleisteten Stunden tatsächlich als weitere Arbeit (Mehrarbeit) zusätzlich zu der vertraglich geschuldeten Wochenarbeitszeit geleistet wurden.
Hat der Arbeitnehmer in dieser Weise vorgetragen, obliegt es nunmehr dem Arbeitgeber, hierzu Stellung zu nehmen und im Einzelnen vorzutragen, welche Arbeiten er dem Arbeitnehmer zugewiesen hatte und an welchen Tagen der Arbeitnehmer von wann bis wann den Weisungen ggf. nicht nachgekommen ist.
Hierauf muss sodann der Arbeitnehmer erneut erwidern und hierbei darlegen und gegebenenfalls beweisen, dass etwaige Mehrarbeit vom Arbeitgeber angeordnet wurden oder zumindest geduldet waren.
Im vorliegen Fall war es so, dass die Arbeitnehmerin vorgetragen hatte, dass sie wöchentlich deutlich mehr als die vertraglich vereinbarten 24 Stunden gearbeitet habe, nämlich jeden Werktag und gelegentlich samstags im Rahmen der Öffnungszeiten der Arbeitgeberin.
Diesem Vortrag ist die Arbeitgeberin nicht in ausreichendem Maße entgegengetreten. Insbesondere wurde keine Arbeitszeiterfassung vorgelegt, aus der sich abweichende Arbeitszeiten hätten ergeben können.
Im Ergebnis was es hier so, dass die fehlende Arbeitszeiterfassung sich nachteilig für die Arbeitgeberin auswirkte. Sie konnte zu den von der Arbeitnehmerin vorgelegten Stundenaufstellungen nicht im erforderlichen Maße Stellung nehmen, da sie selbst nicht über entsprechende Aufzeichnungen verfügte. Auch eine Vernehmung von Zeugen war insoweit nicht hilfreich, da es um einen Zeitraum von insgesamt 3 Jahren ging und die Zeugen sich allenfalls punktuell erinnern konnten.
Das Prozessrecht regelt, dass ein Vortrag einer Partei als wahr unterstellt wird, wenn die andere Partei diesem nicht mit entsprechender Argumentation entgegentritt, sogenanntes Bestreiten bzw. substantiiertes Bestreiten. So war die Sache hier. Dadurch, dass die Arbeitgeberin dem Vortrag der Arbeitnehmerin mangels entsprechender Aufzeichnungen nicht entgegentreten konnte, wurde der Vortrag der Arbeitnehmerin als richtig unterstellt und der Entscheidung des Gerichtes zugrunde gelegt.
Des Weiteren war es so, dass die Arbeitgeberin der Arbeitnehmerin derart viele Aufgaben zugewiesen hatte, dass diese nur dann bewältigt werden konnten, wenn die Arbeitnehmerin während der gesamten Öffnungszeiten für die Arbeitgeberin tätig wird. Insbesondere wurden ihr Aufgaben zugewiesen wie die durchgehende Telefonannahme für die Werkstatt, das Büro und den Verkauf sowie die durchgehende Terminvergabe für die Werkstatt und den Ersatzteilverkauf, die Bedienung der Laufkundschaft mit und ohne Termin und die durchgehende Bearbeitung von Kundenanfragen. Diese Tätigkeiten waren faktisch nur durch eine Vollzeittätigkeit zu schaffen.
Durch die Zuteilung von derart vielen Aufgaben duldete es die Arbeitgeberin letztlich, dass die Arbeitnehmerin kontinuierlich Mehrarbeit leistete. Mehrarbeit ist die Differenz zwischen der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit und der vertraglich geschuldeten. Die Arbeitgeberin hatte auch Kenntnis von der Mehrarbeit, da der Geschäftsführer selbst im Betrieb mitarbeitete und daher täglich mit der klagenden Arbeitnehmerin zu tun hatte.
Insgesamt bleibt hier festzuhalten, dass eine fehlende Arbeitszeiterfassung dazu führen kann, dass der Arbeitgeber nur deshalb Überstundenvergütung zahlen muss, weil er der Überstundenaufstellung des Arbeitnehmers nicht entsprechend entgegentreten kann. Dies ist dann zu seinem Nachteil. Insoweit sollte allen Arbeitnehmern geraten werden, selbst eine detaillierte Auflistung der Überstunden anzufertigen und fortwährend zu führen.