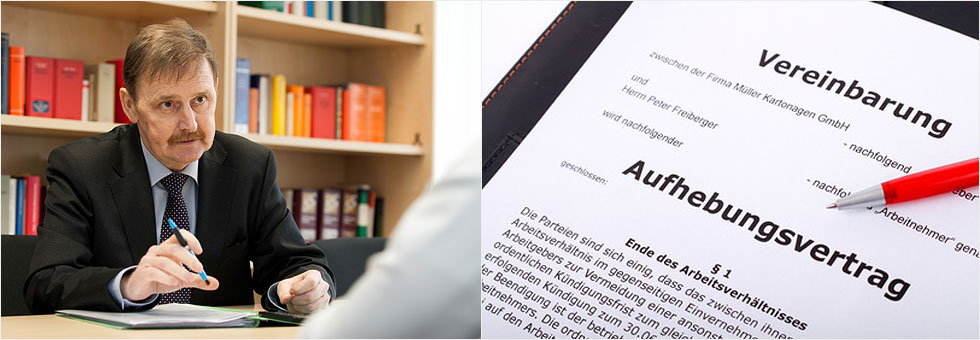
Das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein hat in einer kürzlich veröffentlichten Entscheidung (Urteil vom 22.05.2025 – 5 Sa 284 a/24) entschieden, dass eine Arbeitnehmerin keine Entgeltfortzahlung erhält, wenn sich ein privat gestochenes Tattoo entzündet und die Arbeitnehmerin dadurch arbeitsunfähig wird.
Im Regelfall zahlt der Arbeitgeber nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit die reguläre Vergütung für die Dauer von 6 Wochen weiter.
Dies gilt aber gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Entgeltfortzahlungsgesetz nicht, wenn die Arbeitsunfähigkeit auf ein Verschulden des Arbeitnehmers zurückzuführen ist.
Ein Arbeitnehmer handelt dann schuldhaft, wenn er in erheblichem Maße gegen die von einem verständigen Menschen im Eigeninteresse zu erwartende Verhaltensweise verstößt.
Es wird hier ein objektiver Maßstab angelegt. Dies bedeutet, dass es nicht auf die Sichtweise des betroffenen Arbeitnehmers ankommt, sondern auf die Sichtweise eines durchschnittlichen Arbeitnehmers in der Position des konkreten Arbeitnehmers. Erforderlich ist besonders leichtfertiges oder vorsätzliches Verhalten. Ein Verschulden kann beispielsweise vorliegen, wenn der Arbeitnehmer die Erkrankung und die daraus folgende Arbeitsunfähigkeit wissentlich selbst herbeigeführt hat.
Im vorliegenden Fall war es so, dass sich die Arbeitnehmerin in ihrer Freizeit ein Tattoo hat stechen lassen. Einige Tage danach entzündete sich die betroffene Stelle. Die Arbeitnehmerin ließ sich daraufhin krankschreiben und teilte Ihrem Arbeitgeber mit, dass Sie arbeitsunfähig erkrankt sei. Der Arbeitgeber, dem der Sachverhalt bekannt war, zahlte für den Zeitraum der Arbeitsunfähigkeit kein Entgelt.
Daraufhin erhob die Arbeitnehmerin Klage zum Arbeitsgericht.
Sie argumentierte, dass eine Entzündung im Nachgang einer Tätowierung nur in 1 bis 5 % der Fälle auftrete. Daher habe sie mit einer Entzündung nicht rechnen müssen. Es handele sich um eine unglückliche Folgeerkrankung. Die Tätowierung selbst sei als Teil der privaten Lebensführung geschützt.
Daher habe sie einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung, da sie die Arbeitsunfähigkeit nicht selbst verschuldet habe.
Dahingegen trug der Arbeitgeber vor, dass die Arbeitnehmerin in eine gefährliche Körperverletzung eingewilligt habe, als sie sich tätowieren ließ. Das mit der Tätowierung zusammenhängende Risiko einer Infektion gehöre nicht mehr zum normalen Krankheitsrisiko und könne daher nicht dem Arbeitgeber aufgebürdet werden.
Im Ergebnis folgte das Landesarbeitsgericht der Argumentation des Arbeitgebers.
Es ging davon aus, dass durch die Einwilligung der Arbeitnehmerin in die Körperverletzung (Durchführung der Tätowierung) zugleich ebenfalls ein bedingter Vorsatz im Hinblick auf mögliche Komplikationen vorlag.
Die Arbeitnehmerin musste damit rechnen, dass sich die durch die Tätowierung verletzte Haut entzünden kann.
Das Landesarbeitsgericht wies weiter darauf hin, dass die Tätowierung aufgrund ihrer Durchführung bereits das Risiko einer Hautinfektionen in sich trägt.
Damit bleibt festzuhalten, dass eine Entgeltfortzahlung nicht in jedem Fall von Arbeitsunfähigkeit erfolgt.
Letztlich trifft das Entgeltfortzahlungsgesetz hier eine Abwägung zwischen den Interessen des Arbeitnehmers, seine Vergütung weiterhin zu erhalten ohne entsprechende Gegenleistung, und den Interessen des Arbeitgebers, eine Vergütung dann nicht zahlen zu müssen, wenn der Arbeitnehmer seine Arbeitsunfähigkeit selbst verschuldet hat.